Es ist ruhig an diesem Morgen in Paris. Sehr ruhig. Als wäre die Welt in Watte gehüllt, als wollte sie sich einpacken, sich schützen, sich etwas Geborgenheit zurückholen, etwas Sicherheit. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, vielleicht gar nichts, aber am Flughafen keine Armee, keine Polizei zu sehen, erstaunt mich. Und es beruhigt mich. Das Leben geht weiter, der Alltag hat sich nicht ganz aus dem Konzept, nicht ganz aus dem Tritt bringen lassen. Der perfide Plan, der aufgegangen zu sein schien, ist gescheitert.
Vielleicht sind die Menschen etwas leiser, kaum Hektik ist zu spüren, auch bei den Kontrollen nicht. Die einzig laute Stimme gehört der Flughafenmitarbeiterin, die uns anweist, unsere Gates zu kontrollieren, damit wir den richtigen Shuttle-Bus nehmen. Ein kleines Mädchen weint leise, aus den Lautsprechern an der Decke kommt gedämpfte Musik.
»Je suis Charlie« steht auf der komplett geschwärzten letzten Seite einer Tageszeitung, in die ein junges Paar vertieft ist. Solidarität, Flagge zeigen gegen den Terror, während andere verpixeln. Verstehen wollen. Nur wenige Meter weiter, vor dem Gate, hat ein Moslem seinen Gebetsteppich ausgebreitet. Mit geschlossenen Augen spricht er zu seinem Gott, verbeugt sich in Richtung Mekka, seine Lippen bewegen sich stumm, das Gesicht verrät nicht, was er denkt oder fühlt. Und um ihn herum? Niemand außer mir scheint Notiz von ihm zu nehmen, die Erde dreht sich ganz gelassen weiter. Es könnte so einfach sein.
Eine halbe Stunde später steige ich in ein Flugzeug und fliege nach Westen. Als Paris langsam unter der dichten, grauen Wolkendecke verschwindet und die ersten Getränke verteilt werden, verschwindet auch die Welt. Sie taucht erst drei Stunden später wieder auf, als ich merke, dass sich das Licht verändert hat. Es ist mitten am Tag, und doch ist draußen schon die Dämmerung hereingebrochen. 38.000 Fuß unter uns schwimmen kleine Eisberge im Ozean, dann taucht Island aus dem Nebel auf, kurze Zeit später Grönland, die zugefrorene Baffin-Bay, das ewige Eis. Ein Ausblick, der mir den Atem raubt. Das da unten ist nicht mehr meine Welt. Verschneite Gebirgsketten, kilometerlange Gletscher, nachtschwarze Risse in der weißen Landschaft. Wie fremd ist das alles, wie beängstigend fremd. Wie beängstigend schön.
Ganz, ganz weit weg, denke ich, geht meine Reise. Auf dem kleinen Bildschirm vor mir läuft »The Hundred Foot Journey«, ein Film, in dem eine indische Familie versucht, in einem kleinen französischen Pyrenäen-Dorf, in der französischen Gesellschaft Fuß zu fassen, allen Hindernissen und Vorurteilen zum Trotz. Ganz, ganz weit weg — in eine andere Stadt, ein anderes Land, eine andere Kultur. Doch dann, als das Flugzeug im milchigen Mittagslicht auf dem Boden aufsetzt, am Horizont die Skyline von San Francisco, als ich die Zeitungen sehe mit ihren Schlagzeilen, die Fotos aus Paris, da weiß ich: Ein »Ganz, ganz weit weg«, das gibt es nicht. Das hier unten, das ist meine Welt, meine Realität. Überall.

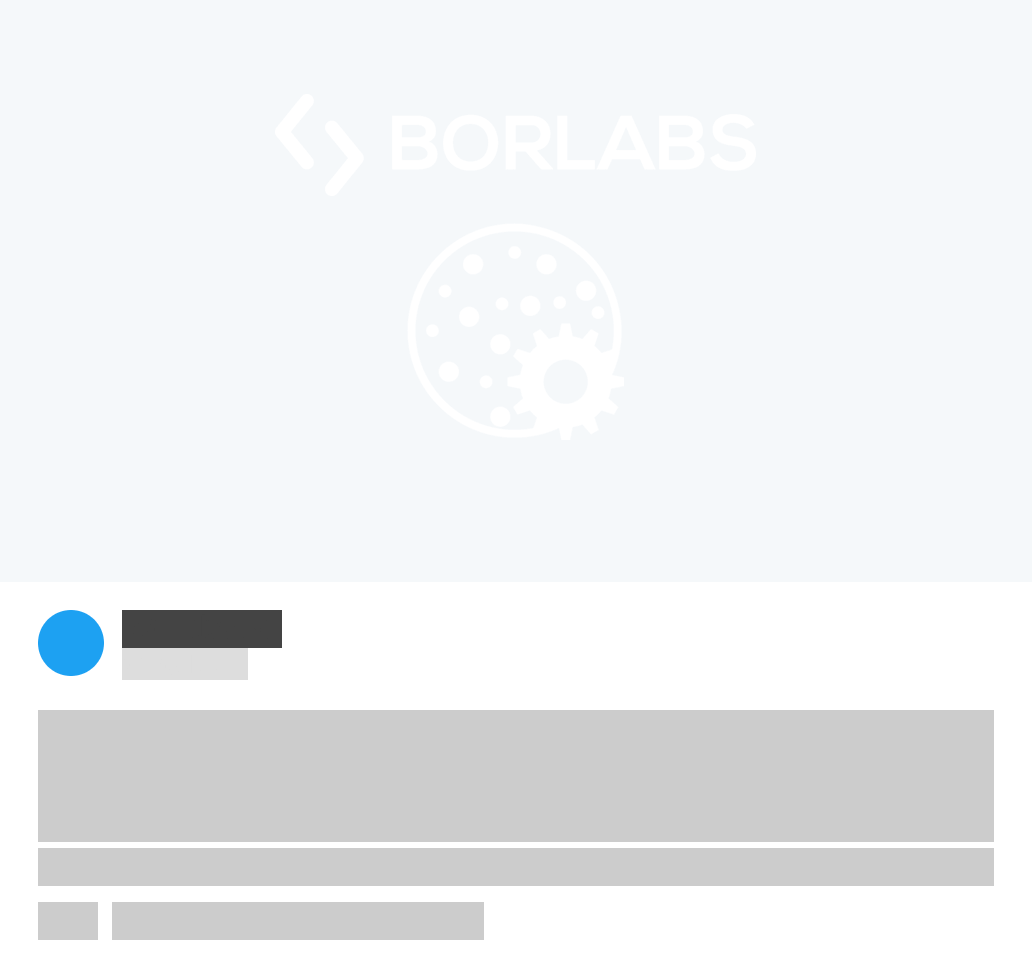
Ein schöner, tiefer Text, der eine Ruhe vermittelt, die man vielleicht nur haben kann, wenn man über den Wolken schwebt. Ich verstehe nur nicht, warum du das Zitat von Jeff Jarvis verwendet hast, abgesehen davon, dass du vermutlich mit ihm übereinstimmst. Das kann man natürlich, auch wenn seine Aussage streitbar ist. Diese Aussage bildet für mich einen Kontrast zu deinem Text, spricht von einer emotionalen, moralistischen Überhitzung, in der sich die meisten, fast alle, am Tag der Morde in Paris befunden haben. Zu Recht, man kann nicht immer ohne Emotion reagieren und das tust du hier ja auch nicht. Du triffst nur einen guten, einen angemessenen Ton. Nachdem ich mich gestern ein wenig über den so viel gelobten Text von Stefan Mesch geärgert habe (nicht öffentlich), sind deine Worte sehr heilsam. Danke. Und eine schöne Zeit in SF.
Danke Dir. Und ich glaube, Du hast Recht. Das Zitat sollte Kontext vermitteln, wo er vielleicht nicht nur nicht nötig ist, sondern sogar stört. Was war denn der Tenor von Stefan Mesch?
Du musst es wohl selbst lesen. Der Text ist gut geschrieben, er vermittelt sogar etwas, dem ich zustimmen kann. Meike schrieb mal einen ähnlichen Text zu Petitionen und ich zu Breaking News. Und es gibt sicherlich noch zahlreiche andere Texte zu diesem Phänomen der Informationsflut und Überreizung. Meines Erachtens hätte Stefan Mesch auf die Überschrift, die nicht so wirklich was mit seinem Text zu tun hat und mir mehr wie clickbaiting vorkommt, verzichten sollen, damit ich ihm abnehme, dass er aus diesem Social-Media-Aufmerksamkeits-Dings treten möchte. Zum anderen stört mich die Eitelkeit, die manchmal zwischen den Zeilen durchschimmert, und auch die Bequemlichkeit. Es ist manchmal so, man möchte abheben, die Dinge weit weg wissen. Ich in meinem Kokon oder über den Wolken. Natürlich sind wir alle bestürzt, überfordert, aufgewühlt und verspüren auch das Verlangen, einfach mal nur das zu sein, was wir sind, ohne Welt und Wahn. Aber manche Dinge verlangen einfach Haltung, was ja nicht bedeutet, dass man nicht überlegen, reflektieren und auch mal «Ich weiß es nicht.» sagen kann. Mich ärgerte wohl entweder das zu schwache politische und soziale Bewusstsein oder auch einfach nur der selbstreferentielle Jammerton. Ich möchte aber auch nicht unfair sein, ich nehme ihm den Text ab, es war nur nicht meine Sorte Text.
Wie dem auch sei, bei dir habe ich das Gefühl, dass du eine klare Haltung hast und dabei zum Glück uneitel bleibst: «…da weiß ich: Ein »Ganz, ganz weit weg«, das gibt es nicht. Das hier unten, das ist meine Welt, meine Realität. Überall.»
Abschließend: Warum ist mein Bild hier weg?
Danke, ich mach mich mal auf die Suche nach dem Stück. Ich glaube, Social Media und Aufmerksamkeit gehören untrennbar zusammen, genau wie Journalismus und Aufmerksamkeit. Das kann gut, kann aber eben auch schlecht sein. Was das Bild angeht: Da fehlte ein »l« in Deiner Mail-Adresse … Hab ich mal eingefügt.
Ein wirklich toller Text!! Konnte mich voll und ganz hineinversetzen und diese Ruhe spüren…